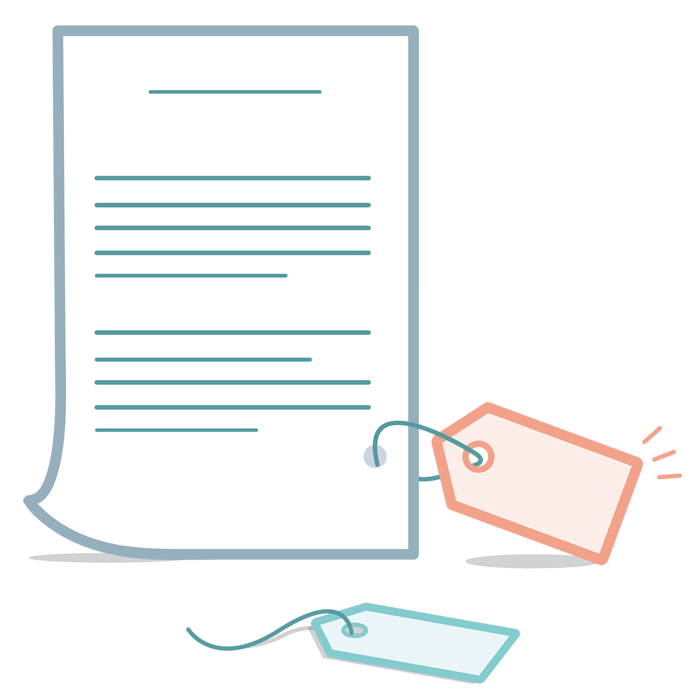Ein Traum Margaretes
Ich saß im Schneidersitz und packte die Äpfel aus dem Korb aus, um sie auf die rot-weiß-gemusterte
Decke zu legen. „Heinrich, Kinder, kommt ihr?“ Die Sonnenstrahlen fielen auf die grüne Wiese, die
sich vor mir erstreckte. Ich wunderte mich schon, wo mein Mann und die Kinder blieben, doch als ich
mich aufrichtete, um nach ihnen zu sehen, fand ich mich an einem völlig anderen Ort wieder.
Mich umgaben nur noch blanke Mauern, die sich in alle Richtungen erstreckten, und von dem
träumerischen Sommertag war keine Spur mehr.
„Margarete“ schallte es durch die engen Gassen. Ich blickte mich um, versuchte die Stimme meiner
Mutter zu finden, doch ich konnte die Richtung, aus der sie kam, nicht erkennen. Ich schrie „Mutter“.
Ich hatte Angst. Wovor hatte ich Angst? Ich konnte mich nicht erinnern.
„Margarete.“ Nun war die Stimme ganz nah, doch sie stammte nicht von meiner Mutter. Ich drehte
mich um und seufzte erleichtert auf. Ich wollte Valentin umarmen, so beruhigt fühlte ich mich, dass
ich nicht mehr alleine war zwischen den düsteren Mauern. Doch der kalte Blick meines Bruders hielt
mich davon ab, auch nur einen Schritt in seine Richtung zu gehen. „Wie konntest du das tun?“ fragte
er, ohne den Blick ein einziges Mal abzuwenden. Ich blickte ihn irritiert an, ich konnte nicht
einordnen, was er damit meinte. Ich wollte ihn fragen, doch ich brachte kein Wort hervor.
Stattdessen redete Valentin weiter. Seine Stimme war kalt, als er sagte „Du trägst die Schuld, das
weißt du doch. Du bist nichts als eine wertlose Hure, du hast uns das angetan.“
Ich riss den Mund auf, wollte etwas sagen, wollte ihn anschreien, was er nur meinte, doch es kam
kein Laut heraus. Seinem vorwurfsvollen Blick hielt ich keine Sekunde länger stand, also senkte ich
meine Augen. Doch was ich dort sah, war in gleichem Maße verstörend. Unter seinem Mantel trat
Blut hervor, das sich an seinen Beinen entlang nach unten erstreckte. Die tiefrote Flüssigkeit schien
eine Spur zu bilden: ich folgte ihr mit meinem Blick über die Pflastersteine bis hin zu meinen Füßen.
Als ich begann, an mir selbst hochzublicken, sah ich zu meinem Verwundern ein Neugeborenes in
meinen Armen liegen. Ich wiegte es leicht hin und her, und mein Gesicht wurde weich.
Ich drehte das Kind ein wenig, sodass ich sein Gesicht sah, doch dann wurde mir klar: das Kleine sah
mich mit den Augen des Teufels an. Reflexartig stieß ich es von mir, und noch in der selben Sekunde
wollte ich die Bewegung zurücknehmen und stürzte nach vorne, griff verzweifelt nach der kleinen
Gestalt, doch schon wurde sie von den dunklen Schatten vor mir verschlungen.
Ich stürzte zu Boden und Tränen sammelten sich auf den Steinen unter mir. Meine Sicht war
verworren, doch vor meinem inneren Auge sah ich klar und deutlich den Anblick, der mir noch immer
den Atem verschlug. Das Gesicht des Teufels. Ich wusste nicht, warum ich mir so sicher war, aber ich
wusste, er war in diesem Blick. Ich hatte ihn bereits einmal gesehen, im schelmischen Grinsen von
Heinrichs zwielichtigem Freund, der ihm auf Schritt und Tritt folgte.
Meine Gedanken stürmten noch immer durcheinander, doch ich setzte mich nun auf. Ich musste ihn
wiederfinden. Ich strich mir den Dreck von meinem Rock, als ich aufstand, und trat in die kleine
Gasse, die sich vor mir erstreckte. Über die Mauern hinweg meinte ich, Stimmen zu vernehmen, doch
ich gab mein Bestes, sie auszublenden und einen Fuß vor den anderen zu setzen.
Ich konnte nicht sagen, wie lange ich lief, vielleicht waren es einige Minuten, vielleicht auch einige
Stunden, doch dann sah ich eine mir allzu bekannte Gestalt.
„Heinrich!“ Ich stürzte auf ihn zu und versank in seinen Armen. „Endlich habe ich dich wieder
gefunden.“ Meine Tränen strömten herunter, doch er gab mir Halt, und seine Wärme beruhigte
mich. Ich spürte, wie sein Griff schwächer wurde, blickte zu ihm auf - und erstarrte vor Schock. Ich
stieß ihn von mir weg, auch wenn seine Hände sich in meine Schulter krallten, konnte ich sie leicht
abschütteln, denn sie waren schwach und dünn. Ich wagte es kaum, meinen Blick erneut auf sein
Gesicht zu richten, doch ich konnte nicht anders. Das war nicht mein Heinrich, aber zugleich war er es
doch. Sein Gesicht war faltig und fahl und seine Haare weiß, als wäre er mit einem Mal um dreißig
Jahre gealtert.
Er sprach zu mir: „Margarete…“